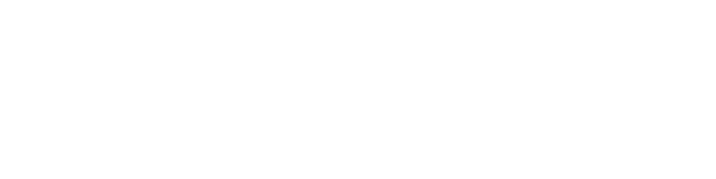Reggae als Katalysator der Zuversicht
Ich hätte schwören können, über Reggae-Gott Bob Marley gäbe es bereits ein Biopic, doch der Eindruck täuschte mich. Was mir so vorkam wie Marley, war womöglich Miles Davis oder James Brown – jedenfalls wundert es mich doch ein bisschen, dass Bob Marley: One Love zum allerersten Mal den Rastafari aus Jamaika auf die große Leinwand bringt. Rastafari – wer sind diese Leute überhaupt? Man kennt Dreadlocks, die gestrickten Mützen in den Nationalfarben Jamaikas, man kennt Haile Selassie, den äthiopischen Monarchen, man kennt den Löwen als Symbol und jede Menge Cannabis, das natürlich geraucht werden muss. Doch was genau hinter dieser Glaubensrichtung steht, spart Reinaldo Marcus Green, seines Zeichens Regisseur von King Richard, insofern aus, da er sein Publikum dazu motiviert, sich selbst auf Recherche zu begeben. Macht aber nichts, wozu gibt es Wikipedia, denn dort lässt sich herausfinden, dass dieser Haile Selassie als prophezeiter schwarzer Kaiser die Reinkarnation des Messias darstellt und die Befreiung Afrikas und all seine Kinder, die über den Erdball verstreut sind, bringen wird. Jah heisst deren Gott, und Bob Marley wird des Öfteren zu ihm beten und ihm huldigen, auch in seinen Liedern.
Rastafari sind friedliebend, vorwiegend gechillt und äußerst rhythmisch veranlagt. Nicht umsonst ist Reggae deren Musik, und dieser Reggae, der schafft es, auch all jene mitzureißen, die noch nie auf Jamaika waren und einen Joint geraucht haben. Reggae, das ist wie guter Stoff in Musikform, da fällt der Stress ab, da entspannt sich der ganze Körper, da bewegt man sich mit dem Flow der prägnanten Klänge, der Trommeln und der Gitarren. Es ist, als wäre man irgendwo am Strand am Meer und könnte die Seele baumeln lassen. Man bräuchte nur die Augen zu schließen und da ist er: Bob Marley, wild gestikulierend und dabei hüpfend wie ein Häschen, seine unverkennbare, einmalige Stimme ins Mikro jaulend und der dabei positiv, beschwichtigend und die Wogen glättend in die Zukunft blickt. Every little thing gonna be alright. Oh ja, so fühlt es sich an, wenn man Marley hört. Mit den Songs, angefangen von No Woman No Cry bis zu seinem Hit-Album Exodus, ist Reinaldo Greens Film ein Best of des Feelgood.
Dabei erweckt ihn Kingsley Ben-Adir tatsächlich zum Leben. Unter der Rasta-Mähne und dem Dreitagebart, mit den richtigen Moves und dem ganzen, womöglich akribisch abgeguckten Gehabe, vermag Adir zu überzeugen. An der Darstellung des VIPs gibt es nichts zu meckern, allerdings gibt es auch keinerlei Versuche, den Künstler umzuinterpretieren. Adir ist Bob Marley – dieser wäre glücklich darüber. Er wäre auch glücklich darüber, wie sorgfältig trapiert seine Hits einer nach dem anderen in diesem Biopic verteilt sind, als hätten wir ein One-Performer-Musical wie Rocketman, das die Kassen dank zahlreicher Evergreens, ausschließlich gesungen von Taron Egerton als Elton John, klingen lassen konnte. Bob Marley: One Love hätte etwas ähnliches werden können, ein Bob Marley-Musical, in welchem der Skipper höchstselbst anhand seiner Nummern über sein Leben sinniert. Da der Glamour eines Elton John einer eingerauchten, wohlwollenden Erdung weichen muss, ist die Form eines Musikfilms wie dieser immer noch am geeignetsten, verknüpft mit biographischen Eckpunkten, die rund um das legendäre Friedenskonzert 1978 in Jamaika angesiedelt sind.
Lässt sich da eine verdichtete Chronik eines Ruhms im Abendrot spinnen? Seltsamerweise wäre Bob Marley: One Love, hätte es all die wunderbaren Lieder nicht, die der mit 36 Jahren an Krebs verstorbene Künstler als ewiges Vermächtnis hinterlassen hat, eine müde Angelegenheit. Weniger straff, dafür etwas unentschlossen, geben szenische Einsprengseln manches aus der Jugend Marleys preis, manches beschäftigt sich wiederum mit der Entstehung des Albums Exodus und manches mit Jamaikas wüster Politik. Doch all diese Facetten wollen sich nur schwer bis gar nicht miteinander verbinden. Das dramaturgische Grundgerüst fällt auseinander, hat aber immer noch Ben-Adir in petto, der stets aufs Neue unbedingt zeigen muss, wie verblüffend gut er das Vorbild imitieren kann. Jedes Mal aufs Neue hängt man an seinen Lippen, wenn er so klingt, wie er klingen soll. Wenn er singt, was er singen soll und wir hören wollen. Die Musik ist letztlich der eigentliche Superkleber in diesem Film, der das Stückwerk notgedrungen zusammenhalten muss. Das ist kein Fehler, dafür gibt’s schließlich jede Menge Benefit: Die gechillten Rhythmen zeitlosen Reggae-Sounds, den richtigen Ohrenschmaus als Antidepressiva.
Mehr Reviews und Analysen gibt's auf filmgenuss.com!
|