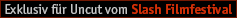
Starkult nimmt zuweilen absurde Formen an. In „Antiviral“ – dem Debut von David Cronenbergs Sohn Brandon – wird dies noch auf die Spitze getrieben: in einer unbestimmten Zukunft können sich besessene Fans die Krankheiten ihrer Vorbilder kaufen. Von statten geht dies folgendermaßen: wenn ein Star erkrankt, fängt die „Klinik“ den Virus ein und stattet ihm mit einem Kopierschutz aus, so dass dieser nicht mehr ansteckend wirkt. Verkauft und injiziert werden die „berühmten“ Viren von Vertretern – Protagonist Cyd March (Caleb Landry Jones) ist so einer.
Wie man bereits an der Prämisse ableiten kann, ist der Film vollgestopft mit Metaphern – z.B. Metaphern über den krankhaften Starkult oder über die Gier der Contentindustrie. Vor allem damit kann „Antiviral“ auch punkten: mit intelligenten Verbindungen zur realen Gesellschaft, äußerst verquer und übertrieben dargeboten. Aber interessante Gedankenprozesse sind bei der Kunstform, wie es der narrative Film eine ist, nun mal nicht alles.
Wo es vor allem hapert, ist beim Character Development. Cyd verkauft die Viren nicht nur an Kunden, sondern gibt sie auch einer Hackergruppe weiter, die versucht den Kopierschutz zu cracken. Weiters ist er ebenso bald von einem Star so besessen, dass er sich selbst zu seinem eigenen Kunden macht und sich mit der lebensbedrohlichen Krankheit des Stars ansteckt. Die Handlungen des Hauptcharakters werden zu keinem Zeitpunkt dem Zuschauer schlüssig dargeboten – vielmehr passiert dies um der übergeordneten Story willen. So kann einen der Film zu einem Großteil eben nicht mitreißen und bleibt ein durchzustehendes Stück Bewegtbild.
Visuell bietet „Antiviral“ nichts Neues, aber durchaus Stimmiges. Der ganze Film ist in sterilem Weiß minimalistisch eingerichtet, was die innerdiegetische Gesellschaft gut wiederspiegelt, aber wiederum das Einfühlungsvermögen des Zuschauers noch zusätzlich erschwert.
Bis zum Ende hin wird freilich auch die Verbindung zum älteren David klar. Bodyhorror der alten Schule bringt Brandon als eine Art Hommage auf seinen Vater auf die Leinwand. Der Film ist ein echter Cronenberg. Ob der Junior allerdings einen eigenen originären Stil entwickeln wird können, bleibt auf einem anderen Blatt geschrieben – muss er aber auch gar nicht.
